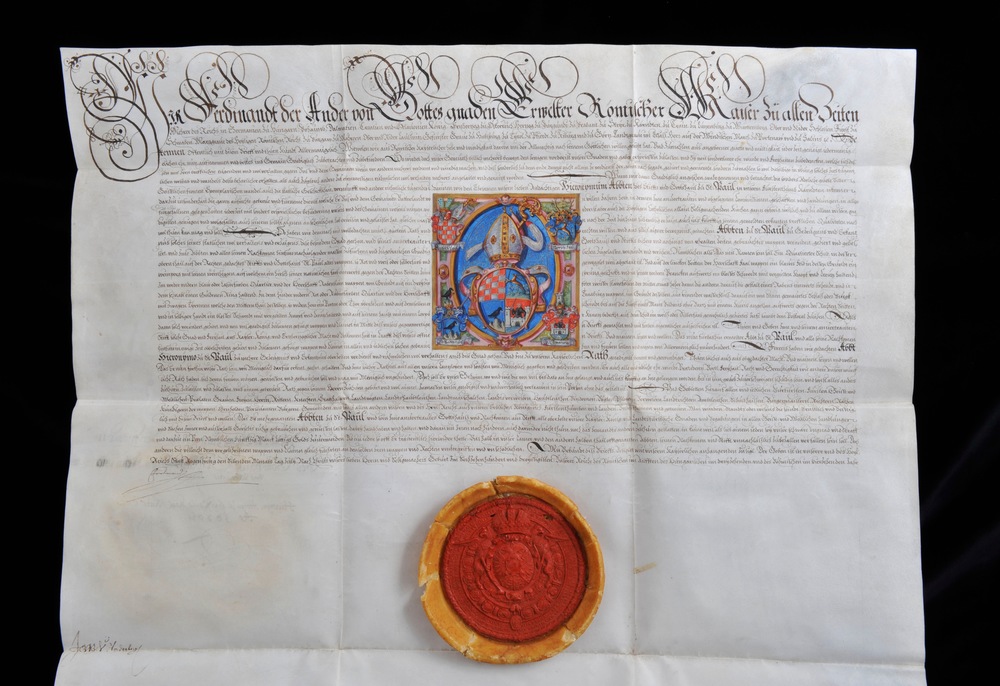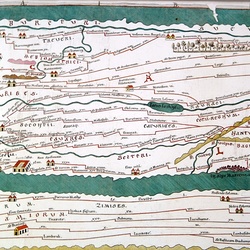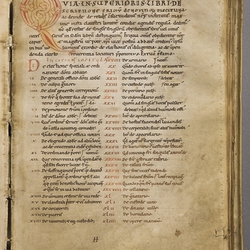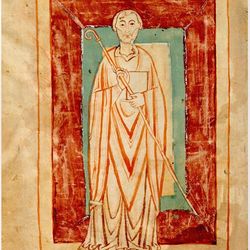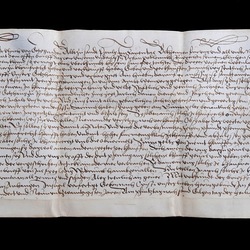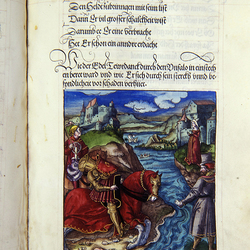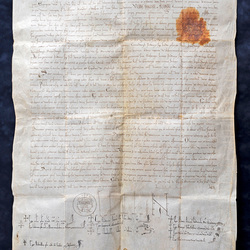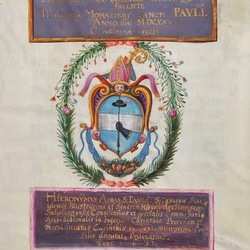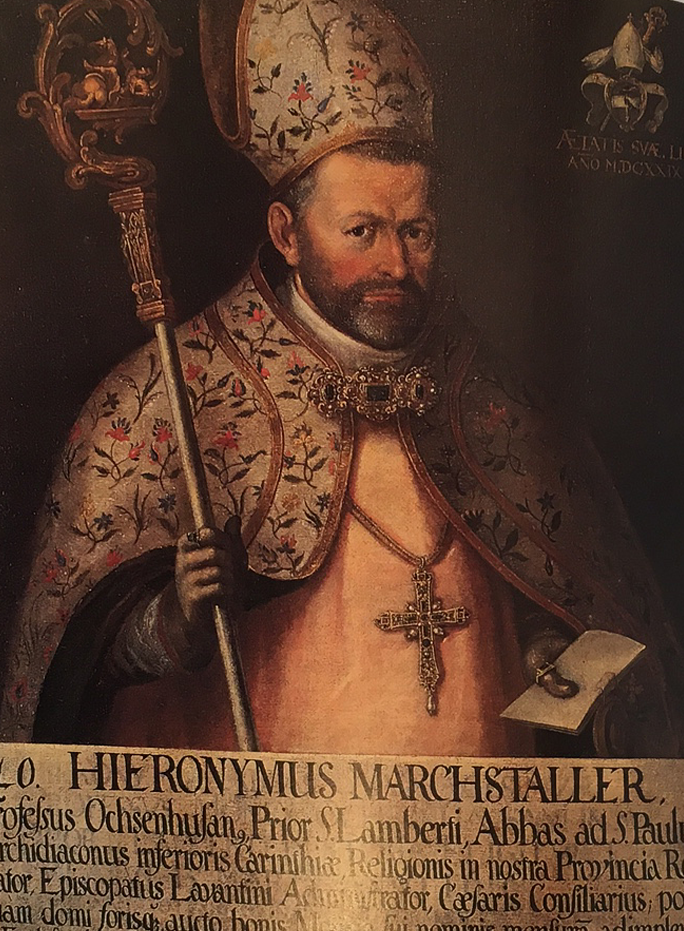Eine wechselvolle Geschichte
Sein zweiter Nachfolger Albert Reichart verfolgte die Pläne des spanischen Escorials. Seine Vorhaben scheiterten allerdings an den zahlreichen Kriegsabgaben, die das Kloster zu entrichten hatte. 1787 löste Kaiser Josef II. das Stift auf, doch bereits 1809 kam neues Leben in die alten Mauern. Fürstabt Dr. Berthold Rottler führte seine Mönche aus dem ebenfalls aufgelösten Kloster St. Blasien im Schwarzwald nach St. Paul. 1940 wurde das Stift neuerlich von den Nazis aufgehoben und 1947 kehrten die Mönche nach St. Paul zurück. Heute leben im Kloster Benediktinermönche, die das "ora et labora et lege" des Heiligen Benedikt als Lebensaufgabe haben.